Jetzt auch noch Metakognition? Auf was soll man denn beim Lernen noch alles achten? Reichen nicht Lernstrategien, Leseverständnis, Motivation, Konzentration und Vorwissen? Metakognition? Was ist das eigentlich?
[Anmerkung zum Text: Ich rede im Text von „Lernern“ und „Lehrern“, gemeint sind damit grundsätzlich alle Geschlechter. Außerdem beziehen sich diese Bezeichnungen nicht nur auf Personen in der Schule, sondern beispielsweise auch auf die Ausbildung und auf alle weiteren Lernumfelder.]
Metakognition ist das Denken über Denken – aber irgendwie kann man sich das nur sehr schwer vorstellen. Man könnte sich Metakognition aber auch als „Zentrale des Lernens“ vorstellen. Ein Ort mit vielen Bildschirmen und Lämpchen. Von dort aus wird das Lernen geplant, gesteuert und überwacht. Um diese Prozesse durchzuführen, muss die „Zentrale des Lernens“ aber auch über metakognitives Wissen verfügen.
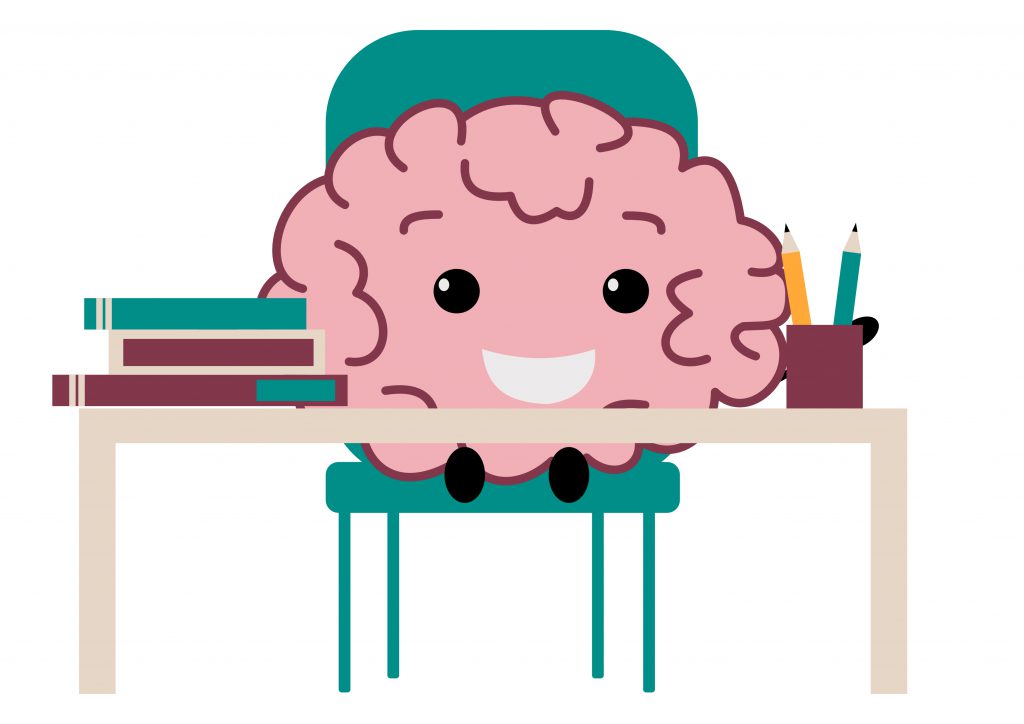
Angenommen der Lerner soll ein Poster zum Thema „Die mittelalterliche Stadt“ gestalten. Dazu verfügt der Lerner über metakognitives Wissen: Wissen über seine Person, die Aufgabe und Strategien. Das bedeutet, der Lerner weiß etwas über sich selbst. Wie gut er im Fach Geschichte ist, wie konzentriert er gerade ist und wie gut er Poster erstellen kann. Der Lerner weiß auch etwas über die Art der Aufgabe, beispielsweise ob diese leicht oder schwierig ist. Außerdem weiß der Lerner auch etwas über die (Lern-)Strategien, die er einsetzen kann, um die Aufgabe zu bearbeiten. Dieses metakognitive Wissen hat der Lerner aus bisherigen Lernerfahrungen erworben. Er könnte beispielsweise in anderen Fächern schon Poster erstellt haben und er weiß aus dem Unterricht, auf welche Unterpunkte er bei Thema „Die mittelalterliche Stadt“ eingehen soll, da diese dort besprochen wurden. Doch das metakognitive Wissen allein ist noch nicht ausreichend, der Lerner muss auch wissen, wie er dieses bei der Erstellung des Posters einsetzt.
Die Metakognition besteht also neben dem metakognitiven Wissen auch aus drei metakognitiven Prozessen. Diese umfassen die Planung, Überwachung und Steuerung. Der Lerner geht seine Aufgabe an und beschließt sich erst mal einen Plan zu machen. Er überlegt, welche Materialien und Bücher er benötigt, wie viel Zeit ihm für die Bearbeitung zur Verfügung steht und wie er vorgehen möchte. Dann beginnt er mit der Bearbeitung und überwacht gleichzeitig sein Vorgehen. Dazu fragt er sich, ob er seinem Ziel näher kommt, ob der ausgewählte Text zum Thema passt und ob die eingesetzten Strategien hilfreich sind. Treten während der Bearbeitung Störungen auf, muss der Lerner seine Aufmerksamkeit steuern. Es könnte beispielsweise sein Handy klingeln oder seine Gedanken schweifen ab. Um dann gut weiterzuarbeiten, muss sich der Lerner regulieren. Diese drei metakognitiven Prozesse laufen jedoch nicht nacheinander ab, sondern parallel. Denn auch während der Bearbeitung des Posters kann der Lerner beispielsweise feststellen, dass er nicht mehr genügend Zeit für die Bearbeitung hat und somit einen neuen Plan erstellen muss.
Gute Lerner führen das beschriebene Lernverhalten meist ganz automatisch durch und oft sind sich die Lerner dieser Schritte nicht mal bewusst. Problematisch wird es meist erst, wenn Störungen bei der Aufgabenbearbeitung auftreten oder die Lerner die gewünschten Leistungen nicht erreichen. Um Metakognition zu üben, ist es daher wichtig, die drei metakognitiven Prozesse nicht isoliert und einmalig zu üben. Das mehrmalige Üben muss im Kontext von konkreten Lernaufgaben stattfinden und die dabei ablaufenden metakognitiven Prozesse thematisiert und angeleitet werden.
Mein Kommentar:
Zwei Aspekte sind mir bei dem Thema besonders wichtig: Erstens ist Metakognition kein neues, isoliertes Thema, was man „jetzt auch noch“ angehen muss. Die beschriebenen Prozesse laufen beim erfolgreichen Lernen sowieso ab – meist ohne dass es dem Lerner bewusst ist. Es geht also nicht um etwas Neues, sondern um etwas, was schon immer da war. Genauer betrachtet sind diese Prozesse auch ein Kernelement des selbstregulierten Lernen und somit bedeutungsvoll für den Lernerfolg – ohne Metakognition geht es praktisch nicht.
Zweitens sind die genannten Prozesse sehr komplex und verlangen dem Lerner einiges ab. Als Experte in einem Thema oder erfahrener Lerner übersieht man die Komplexität häufig, weil man selbst auf ein großes Erfahrungswissen (metakognitives Wissen) zurückgreifen kann. Bewusst wird es einem oft erst, wenn man sich beobachtet, wie man selbst neue Aufgaben angeht und unbekanntes Terrain betritt. Dann spürt man möglicherweise wieder die Unsicherheit: Wie soll ich vorgehen? Wie mache ich das am besten? Wie lang wird das wohl dauern? Hinzu kommt, dass das Wissen von einem Fach- oder Themengebiet sich nicht so einfach übertragen lässt. Daher hilft losgelöstes Strategietraining meist auch wenig.
Literatur:
Bannert, M. (2007). Metakognition beim Lernen mit Hypermedien. Erfassung, Beschreibung und Vermittlung wirksamer metakognitiver Strategien und Regulationsaktivitäten (Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie, Bd. 61). Zugl.: Koblenz, Univ., Habil.-Schr., 2004. Münster: Waxmann.
Dornheim D., Weinert S. (2019) Kognitiv-sprachliche Entwicklung. In: Urhahne D., Dresel M., Fischer F. (eds) Psychologie für den Lehrberuf. Springer, Berlin, Heidelberg
Veenman, M. V. J. (2011). Learning to Self-Monitor and Self-Regulate. In P. A. Alexander & R. E. Mayer (Hrsg.), Handbook of research on learning and instruction (Educational psychology handbook series, p. 197–218). New York: Routledge.